Die Ideologie des Proprietarismus
Teil 1 der Artikelserie »Vorwärts in die Sklaverei, Proprietarismus im Aufwind«
»Ogni tempo ha il suo fascismo«
»Jede Zeit hat ihren eigenen Faschismus«
Primo Levi, Schriftsteller und Holocaust-Überlebender, 1974
Zusammenfassung des Artikels
Als Proprietarismus bezeichnen wir eine Ideologie, die sich vor allem durch eine Überbetonung von Eigentumsrechten gegenüber sozialer Teilhabe auszeichnet. Das Milieu der proprietaristischen Rechten bezeichnet sich selbst irreführenderweise als »libertär« und »freiheitlich«.
AnhängerInnen des Proprietarismus sehen die herrschende bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft permanent an der Schwelle zum »Sozialismus« und halten Steuern für staatliche Bevormundung oder gleich für Raub. Sie fordern den Abbau des Sozialstaats, agitieren gegen KlimaschutzmaßnahmenDer Kampf gegen die ökologische Wende und damit einhergehend die Leugnung der Fakten des Klimawandels ist ein Hauptthema der rechten Verschwörungsszene. »Klimalüge«, »Klimahysterie« und »Klimawahn« sind Schlagworte ihrer Propaganda. Auf den Aufzügen wird immer wieder die Klimaschutz-Bewegung angefeindet. Der Spruch »I love CO₂« ist in der Szene verbreitet. Der in der Szene vorherrschende gesellschaftsfeindliche Freiheitsgedanke meint, den eigenen Lebensstil und… Weiterlesen und Gleichstellungspolitik. Sie erträumen sich eine ungezügelte Herrschaft des Kapitals. Dabei spielen sozialdarwinistischeSozialdarwinismus ist ein Kernelement rechter Ideologie. Er gründet im Biologismus und überträgt die Evolutionstheorie von Charles Darwin eins zu eins auf menschliche Gesellschaften. Daraus folgen die Überzeugungen von einem ständigen »Kampf ums Dasein«, der Selbstverständlichkeit sozialer Hierarchien und der Ungleichwertigkeit von Menschen. Dies bewirkt eine verachtende Perspektive auf Menschen, die körperlich, intellektuell oder ökonomisch als schwächer angesehen werden. Sie werden… Weiterlesen Ressentiments gegen Arme eine große Rolle.
In etlichen Ländern der Welt – auch in Deutschland – versucht die proprietaristische Rechte »Privatstädte« zu errichten, die von UnternehmerInnen geführt werden sollen. Diese wären eine Plutokratie und ein Rückfall in den Feudalismus. Gerade hier treffen proprietaristische und neofaschistische Rechte zusammen.
Die proprietarische Szene ist vielseitig und bewegt sich zwischen extremen Rechten, AfDDie AfD ist ein Sprachrohr der rechten Verschwörungsszene. PolitikerInnen der AfD im Rhein-Main-Gebiet verbreiten rechte Verschwörungsmythen vom »Great Reset«, »Großen Austausch«, »Hooton-Plan« u.a. Beispiele sind Ramona Storm, Frank Grobe, Sandra Scheld. Andreas Lichert, Landessprecher der AfD in Hessen, schwadroniert über eine »Symbiose von Öko-Sozialisten und Großkapital« zur Durchsetzung eines »Ökosozialismus«. Hartmut Issmer wettert in Reden gegen eine »internationale Hochfinanz«, die… Weiterlesen, Werteunion, CDU und FDP. In diesem ersten Artikel der mehrteiligen Artikelserie wird vor allem die zugrundeliegende Ideologie erläutert.
Der zweite Teil der Artikelserie zeigt am Beispiel des Hayek-Clubs Frankfurt, wie tief das proprietaristische Milieu in den Wirtschaftsverbänden und in der Frankfurter Stadtgesellschaft verankert ist. Während sich der Hayek-Club Frankfurt um Distanz nach rechtsaußen bemüht, schmieden andere Akteur*innen skrupelosl das Bündnis mit AfD und ReichsbürgerInnen. So etwa die Atlas-InitiativeDie Atlas-Initiative ist eine proprietaristische Organisation, die 2018 in Frankfurt gegründet wurde und dort ihren Sitz hat. Sie steht der AfD nahe und bietet Corona-Leugner*innen, Klimawandel-Leugner*innen und migrationsfeindlichen, rassistischen Positionen eine Plattform. Ihr inhaltlicher Kern ist die Forderung nach einem staatlich unregulierten Markt und die Diskreditierung sozialstaatlicher Errungenschaften als sozialistisch. Die Initiative besteht formal aus zwei Vereinen: Atlas – Initiative… Weiterlesen, die im dritten Teil der Serie Thema sein wird.
Eine Stadt, in der die Feuerwehr nicht für jeden ausrückt, in der es keine Polizei gibt, sondern nur private Sicherheitskräfte, und in der über Lehrpläne an Schulen und Universitäten bestimmt, wer das meiste Geld hat. Das ist keine Dystopie aus einem Science-Fiction-Roman. Die Gründung solcher Privatstädte, in der kein Staat und keine Regierung sich in die Entscheidungen der Superreichen einmischt, ist längst konkreter Plan. Die Kräfte, die ihn verfolgen, agieren unverfroren und haben großen politischen Einfluss.
Sie sind marktradikal, sozialchauvinistisch und extrem rechts. Seit Jahren wächst das Netzwerk aus Ultraneoliberalen, die den Sozialstaat abschaffen wollen und von Privatstädten träumen. Sie nennen sich »libertär«, weil ihnen ihre »Freiheit« (lat. libertas) so wichtig ist. Dabei geht es ihnen jedoch nicht um universelle und soziale Freiheitsrechte, wie sie in der Verfassung festgelegt sind, sondern um die uneingeschränkte Freiheit des Kapitals und des Wirtschaftens ohne jegliche Verpflichtung gegenüber Staat und Gesellschaft.
Wir bezeichnen diese Szene und ihre Ideologie als Proprietarismus: Die Überhöhung des Eigentums (lat. proprietas) ist ihr ideologischer Fixpunkt. In der Finanzmetropole Frankfurt am Main begegnen sich verschiedene Strömungen dieses Spektrums, das längst Bewegungscharakter hat und dessen Einfluss stetig zunimmt.
Die Szene ist wandlungsfähig, vielschichtig und von Spannungen durchzogen. In ihr herrscht die Gleichzeitigkeit reformistischer und revolutionärer Ansätze. Die einen suchen die Nähe zu den Regierenden und wollen den Staat verändern, andere paktieren mit ReichsbürgerReichsbürger bilden ein heterogenes Spektrum von AktivistInnen und Gruppen, die den Fortbestand des Deutschen Reiches propagieren. Je nach Gruppierung wird dabei auf das Deutsche Reich in unterschiedliche territorialer Ausdehnung Bezug genommen oder es werden eigene »Königreiche« ausgerufen. Dabei verfließen die Kreise der Reichsbürger mit denen der SelbstverwalterInnen. Reichsbürger behaupten u.a., dass Deutschland kein souveräner Staat sei, sondern ein Konstrukt der… Weiterlesen*innen und wollen den Umsturz. Die einen geben sich elitär, andere inszenieren sich als »Anwalt des kleinen Mannes«.
Manche ihrer Protagonist*innen sind etablierte Banker, Unternehmensberater oder anderweitig der Finanzsphäre zugehörig. Andere stehen den etablierten Kapitalmärkten aus Banken und Wertpapierbörsen ablehnend gegenüber, weil sie bereits hier zu starke staatliche Einflüsse sehen. Manche betätigen sich als Gurus für den »Systemausstieg«, wie man es aus der rechten VerschwörungsszeneAls rechte Verschwörungsszene, rechte Verschwörungsbewegung oder rechtes Verschwörungsmilieu bezeichnen wir das Spektrum der Personen, die eine Verschwörungsmentalität und eine geteilte Identität als »Freiheitsbewegung« und »Wahrheitsbewegung« verbindet. Die Angehörigen der Szene organisieren sich in analogen und virtuellen Gruppen und Plattformen und verfügen über ein eigenes Netzwerk »alternativer Medien«. Mit den Corona-Protesten Anfang 2020 bildete sich eine Bewegung heraus, die sich beständig… Weiterlesen kennt. Sie schwören auf den privaten Erwerb von Edelmetallen oder den Kauf von Kryptowährungen – beides entzieht sich der staatlichen Kontrolle und ist vermeintlich krisensicher. Andere setzen sich vehement für den Erhalt von Bargeld ein. Oder sie verkaufen Workshops zu »Steuerspartricks« oder verdingen sich als Crash-ProphetenAls »Crash-Propheten«, auch Krisenpropheten, wird ein Kreis von Geschäftemacher*innen bezeichnet, die einen baldigen wirtschaftlichen Zusammenbruch in Deutschland voraussagen, um aus der Verunsicherung der Menschen Kapital zu schlagen. Sie vertreten in der Regel eine marktradikale, rechtslibertäre Ideologie, einige von ihnen stehen der AfD nahe. Beispiele sind Max Otte (ehemaliger Vorsitzender der WerteUnion), Thorsten Schulte und Markus Krall. Rechte Crash-Prophet*innen (tatsächlich treten… Weiterlesen.
Viele sind verbunden mit der rechten Verschwörungsszene, der WerteUnion und der AfD, manche mit FDP, CDU und CSU. Auch eigene Parteigründungsprojekte wie die Partei der Vernunft oder die Partei Die Libertären werden verfolgt. Erst kürzlich kündigte Frauke Petry, einst AfD-Vorsitzende, die Gründung einer neuen Partei an, die eine vermeintliche »Leerstelle eines anti-etatistischen, freiheitlichen Angebots« füllen solle – gemeint ist damit eine weitere Partei, die der proprietaristischen Rechten zugehörig wäre.
»Libertarismus« – der Rechtsruck des Liberalismus
Im deutschsprachigen Raum bezeichneten sich ursprünglich vor allem linke, anarchistisch oder antiautoritär geprägte Gruppierungen als libertär. In diesem Sinne versteht sich Libertarismus als ausdrücklicher Gegensatz zu jeder Form von Autoritarismus. Doch eine rechte Deutung von »Libertarismus« entreißt den Linken zunehmend den Wortgehalt.
Rechte Libertäre sind minarchistisch, streben also einen möglichst schlanken Staat, einen »Nachtwächterstaat« an, oder gleich »anarchokapitalistisch«, wollen also den Staat gänzlich abschaffen und alle staatlichen Aufgaben der Privatwirtschaft übergeben. Ihre VordenkerInnen werden von ihnen heldengleich verehrt, etwa die Schriftstellerin Ayn Rand (1905-1982) oder die Ökonomen Friedrich August von Hayek (1899-1992), Ludwig von Mises (1881-1973), Milton Friedman (1912-2006) und Murray Rothbard (1926-1995).

Ein dichtes Netzwerk aus Instituten, Vereinen und Initiativen propagiert diese Idee, befeuert auch durch US-amerikanische Think-Tanks. Von den Wahlsiegen von Javier Milei in Argentinien und Donald TrumpDer US-amerikanische Präsident Donald Trump ist in vielen Ländern eine Kultfigur der Rechten. Obwohl er vielfach der Lügen und Bereicherung während seiner ersten Regierungszeit überführt ist, schuf er sich dort das Image des aufrichtigen Anti-Politikers, der gegen ein korruptes Establishment kämpfe. Seine Ideologie und sein Regierungsstil werden als Trumpismus beschrieben. Sie sind nationalistisch, populistisch, sexistisch, minderheitenfeindlich, chauvinistisch, personenzentriert und autoritär,… Weiterlesen in den USA sehen sie sich bestätigt. Milei, Trump und sein Ex-Berater Elon Musk gelten ihnen als Pioniere einer neuen staatlichen Ordnung, die kapitalistische Entfesselung und daraus folgenden Wohlstand verheißen soll – zum Wohle weniger, zulasten sozialer Sicherungssysteme und der Rechte von Lohnabhängigen und Arbeitslosen, wohlgemerkt.
Im klassischen Sinne bezeichnet Liberalismus eine politische Großideologie, die vor allem auf die Umwälzungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts zurückgeht: In der Amerikanischen und Französischen Revolution wurden neue Gesellschaftsordnungen erkämpft, in der die Idee des demokratischen Rechtsstaats verwirklicht werden sollte. Liberalismus befürwortete hier – im Gegensatz zu den überkommenen feudalen Ordnungen des Absolutismus – die Freiheit des Einzelnen, Rechtsstaatlichkeit, gesellschaftlichen Pluralismus und sozialen Wandel. Die Rechtssicherheit sollte durch Gewaltenteilung, unabhängige Gerichtsbarkeit und Minderheitenschutz geschaffen werden. Ziel eines so verstandenen Liberalismus ist es, dass sich die Individuen frei von Zwängen und Gewalt gesellschaftlich begegnen und austauschen, sich selbst regieren, Minderheiten respektieren und die freie Entfaltung der Persönlichkeit nur dort eine Grenze findet, wo sie andere beschneidet.
In jedem Fall ist der Liberalismus zu würdigen als jene politisch-philosophische Position, die die rechtsstaatlich verfassten Demokratien der Neuzeit begründet hat und mit ihnen vergleichsweise starke Gleichberechtigung und Freiheitsrechte. Auf der anderen Seite ist liberales Denken historisch eng mit dem Aufkommen des Kapitalismus verbunden, koloniale und patriarchale Systeme blieben bestehen und bekamen gar ideellen Rückhalt seitens des Liberalismus.
Die Gesellschaft als Geschäftsfeld
Der Libertarismus-Begriff der proprietaristischen Rechten ist vom Liberalismus abzugrenzen. Auch wenn es Schattierungen und Graubereiche gibt. Besser als Libertarismus beschreibt daher der Begriff des »Proprietarismus«, was diese Gruppen fordern.
Proprietarismus lässt sich in vielerlei Hinsicht als kompromiss- und hemmungslose Form des Neoliberalismus verstehen. Er wird deswegen teils auch als Ultraneoliberalismus bezeichnet. Die dahinterliegende Eigentumsideologie führt häufig zu offener GesellschaftsfeindlichkeitDie rechte Verschwörungsszene denkt und handelt gesellschaftsfeindlich und chauvinistisch. Vor allem in der rechten libertaristischen Ideologie, die großen Einfluss in dieser Szene hat, bildet gesellschaftsfeindlicher Chauvinismus die Maxime des Handelns. Damit ist folgendes gemeint: Die Szene versteht sich selbst als eine »Freiheitsbewegung«, doch wird in ihr Freiheit als rein individuelles Anrecht verstanden. Eigene Interessen werden ungeachtet möglicher Nachteile für andere… Weiterlesen und Sozialdarwinismus. Gesellschaft sieht man hier vor allem als ein Geschäftsfeld, aus dem man die größtmögliche Rendite ziehen sollte, und nicht als Solidargemeinschaft, die auch benachteiligte Menschen einbezieht und unterstützt.
In Deutschland hat die Rechte in den vergangenen Jahren, angetrieben auch vom Geist des Proprietarismus, die Politik kontinuierlich vor sich hergetrieben. Unentwegt zeichnete sie, begleitet von manchen »Leitmedien«, das Schreckensszenario vom Niedergang der Wirtschaft und dem damit verbundenen sozialen Abstieg vieler Millionen Menschen. Richtig ist jedoch, dass zugleich die Zahl der Superreichen in Deutschland von Jahr zu Jahr zunimmt. Während der Corona-Pandemie, die viele Menschen in Existenznot stürzte, erlebten hierzulande die reichsten der Reichen einen wahren Goldrausch und konnten ihre Vermögen beträchtlich mehren.
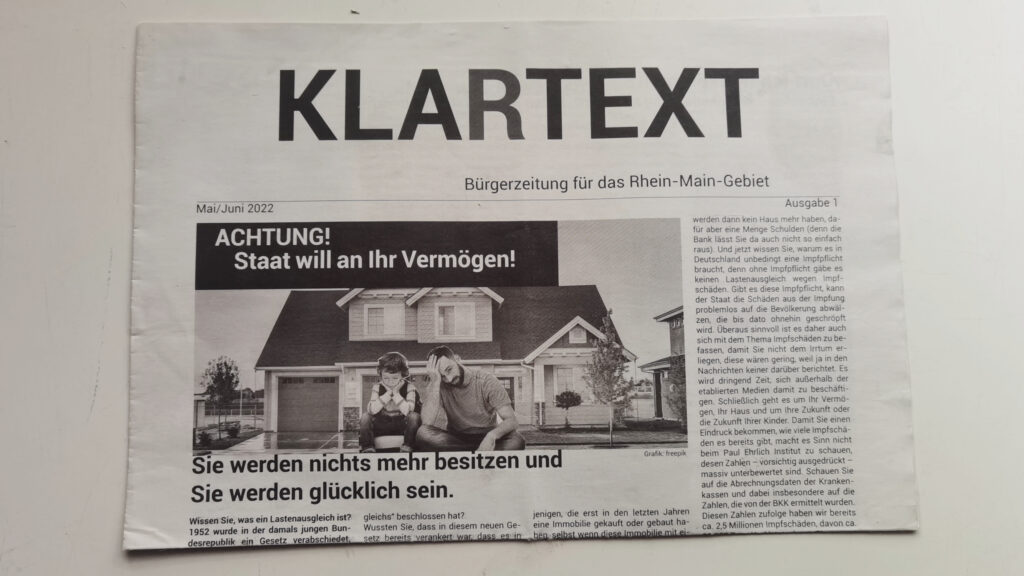
Diese Entwicklung bewirkte keine große Debatte um Verteilungsgerechtigkeit. Stattdessen verfing die rechte Propaganda, wonach die Bürger*innen vom Staat ausgenommen, bevormundet und entmündigt würden und der Sozialismus – heutzutage auch gern: der Ökosozialismus»Ökodiktatur«, »Klimasozialismus« und »Klima-Extremismus« dienen der Rechten als politische Kampfbegriffe, um ökologisch nachhaltige Politik zu diffamieren. Sie unterfüttern häufig Verschwörungsmythen, in denen der menschengemachte Klimawandel geleugnet oder verharmlost wird. Mit den Begriffen werden Maßnahmen zum Schutz von Klima und Natur diskreditiert, die als einschränkend und bevormundend empfunden werden. Politische Positionen werden angegriffen, die sich u.a. für Tempolimits auf Autobahnen, Dieselfahrverbote,… Weiterlesen – vor der Tür stünde. Dabei konnte man auf einem Antikommunismus aufbauen, der sich über die Nazidiktatur und den Kalten Kriegs tief ins kollektive Bewusstsein eingebrannt hat. Gegen diesen bevorstehenden Sozialismus helfe – so behauptet die proprietaristische Rechte – nur eine Rückbesinnung auf Eigentum und die Kräfte des Marktes.
Dass proprietaristische Ideologien zusehends den Charakter politischer Bewegungen annehmen, kommt nicht von ungefähr: Die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Ordnung ist im 21. Jahrhundert deutlicher denn je. Mit globalen Problemen wie der Klimakatastrophe kann das an Wachstum und Profit orientierte kapitalistische Weltsystem nicht umgehen, sie werden nicht gelöst. Der neoliberale Kapitalismus wandelt die Menschen zu individualistisch-egoistischen Profitmaximierern. Auch in Industriestaaten des globalen Nordens stagnieren die Reallöhne seit Jahrzehnten und die Abstiegsängste nehmen zu. Eine solidarische Lösung dieser Probleme scheint in weiter Ferne.
Die radikale Antwort der proprietaristischen Szene: Mehr Kapitalismus sei nötig, nicht weniger. So wird die krisenhafte Realität als Folge einer noch unzureichenden Durchsetzung des Kapitalismus angesehen. Dass ein Mehr an Kapitalismus jedoch zulasten jener ginge, die von der Wirtschaft und der Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstands nichts zu erwarten haben, ist nachrangig. Es geht darum, den eigenen Status abzusichern.

Fakten des Klimawandels werden bestritten
Ein wesentlicher propagandistischer Zug ist die Leugnung der Fakten des Klimawandels, die in dieser Szene betrieben wird. Wenn statt gesellschaftlicher Verantwortung der individuelle Erfolg – gemessen in Kapital – im Mittelpunkt steht, dann stören warnende Worte nur und müssen als »Klimahysterie« diskreditiert werden. Die Ausbeutung von Mensch und Natur soll ohne Skrupel bis zum bitteren Ende betrieben werden. Insbesondere hier offenbart sich eine rassistische und klassistische Herrschaftsideologie: Diejenigen, die über Geld und Einfluss verfügen, werden sich noch einige Zeit länger vor den verheerenden Folgen der Klimaerwärmung schützen können. Sie werden sich den Zugriff auf knapper werdende lebenswichtige Ressourcen wie Wasser und Nahrungsmittel sichern und in klimatisierten Räumen weiter ihren Geschäften nachgehen können. Arme und Unterprivilegierte vor allem im globalen Süden werden die hauptsächlichen Leidtragenden von Dürren, Stürmen und steigendem Meeresspiegel sein. Für die ProprietaristInnen ist dies keine Frage von Moral, sondern ein natürlicher und unabwendbarer Prozess.
Anfang 2020 verbreitete die Homepage klimafragen.org einen Aufruf, der die Klimapolitik der schwarz-roten Regierungskoalition als unwissenschaftlich und zu einschränkend angreift. Es wird behauptet, dass der Klimawandel »kein relevantes Problem für die Menschheit« sei. Dazu wird das bekannte Mindset der Leugnung der Klimawandel-Fakten abgespult: Dass es »prominente Wissenschaftler« gebe, welche »die Hypothese vom gefährlichen menschengemachten Klimawandel ablehnen« würden, dass der CO2-Anstieg zu einem Ergrünen der Erde führe und die Lebensumstände vieler Menschen verbessern könne; dass der »politisch induzierte ›Klimaschutz‹ ökonomisch und gesellschaftlich mehr Schaden« anrichten würde, »als es ein Klimawandel je könnte«.
Unterstützt wurde der Aufruf von AutorInnen rechter Publikationen, von Mitgliedern der AfD, FDP und CDU sowie von der Atlas-Initiative, der Werteunion Bayern und vom stramm rechten Deutschen Arbeitgeber Verband mit Sitz in Wiesbaden. DER SPIEGEL sah darin ein »informelles Bündnis zwischen Neuen Rechten und Klimawandelleugnern«.

Verantwortlich für den Aufruf waren zwei bekannte Personen des proprietaristischen Milieus: Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Carlos A. Gebauer, stellvertretender Vorsitzender der Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft und Titus Gebel von der Free Cities Foundation (siehe nachfolgend). Als Erstunterzeichnende trugen sich 30 weitere Personen ein. Unter diesen sind: Thorsten Polleit (Königstein im Taunus) und Andreas Marquart (Obernburg am Main), beide vom Vorstand des Ludwig von Mises Instituts Deutschland; Markus KrallMarkus Krall ist ein Crash-Prophet und Sprachrohr des proprietaristischen Spektrums. Er ist Buchautor und Vorsitzender der Atlas-Initiative. Als Vortragsredner tritt er häufig in Kreisen der rechten Verschwörungsszene auf. Im Sommer 2024 zog er von Frankfurt in die Schweiz. Krall war bis Dezember 2023 Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH. Das Unternehmen entließ ihn kurz vor der Durchsuchung seiner… Weiterlesen, Vorsitzender der Atlas Initiative und zu dieser Zeit noch in Frankfurt wohnhaft; Björn Olaf Peters aus Kelkheim, Vorsitzender des Deutschen Arbeitgeber Verbands und Betreiber des Unternehmens Peters Coll, welches sich »Forschungs- und Beratungsinstitut für Energiewirtschaft und -politik« nennt, jedoch Propaganda für Atomkraft betreibt; sowie Ramin PeymaniRamin Peymani aus Kelkheim ist Crash-Prophet, Politiker der FDP und Vorstandsmitglied des proprietaristischen Hayek-Clubs Frankfurt am Main. Er verbreitet als Blogger, Buchautor und Vortragender rechtspopulistische Propaganda und Verschwörungsmythen. Peymani schrieb mehrere Bücher und betrieb bis 2022 den Blog Liberale Warte, über die seine Weltsicht und seine Einbindung ins rechtspopulistische Spektrum deutlich wird, bspw. durch die enge Zusammenarbeit mit dem Blog… Weiterlesen, ebenfalls aus Kelkheim, Mitglied im Kreisvorstand der FDP Main-Taunus und Vorstandsmitglied des Hayek-Clubs Frankfurt.
Die Homepage Klimafragen.org wurde Ende 2023 abgeschaltet, ihr Aufruf kursiert jedoch noch immer in rechten Kreisen.
Die Herrschaftsideologie, die dem Proprietarismus innewohnt, zeigt sich auch in anderen Positionen. Etliche seiner ProtagonistInnen bedienen sich rassistischer und antisemitischerAntisemitismus ist eine tragende Ideologie der rechten Verschwörungsszene und tritt dort in vielen Facetten in Erscheinung. Als übergeordnete Verschwörungsmythos dient der Szene ein angeblicher Plan einer »globalistischen Elite« zur Schaffung einer Neuen Weltordnung. Darin spiegeln sich viele Elemente der seit fast 2000 Jahren virulenten Erzählungen von einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung wieder: Die Ansicht, dass »heimatlose« Jüd*innen kultur- und heimatlose »Einheitsmenschen«… Weiterlesen Narrative und agitieren gegen Feminismus und LGBTQ-Rechte.
Vorwärts in die Sklaverei: Die »Privatstadt«
Eine zentrale Idee des Proprietarismus ist die Gründung von Privatstädten in »Sonderwirtschaftszonen«. Hier soll der Traum vom Leben ohne staatliche Eingriffe verwirklicht werden. Alle Beziehungen, die in modernen Staaten von der öffentlichen Hand geregelt werden, wären hier privatisiert: Von der Wasserversorgung bis zur Kanalisation, von der Polizei über die Schule bis zur Feuerwehr. Wessen Haus brennt, der ist gut beraten, eine private Feuerversicherung abgeschlossen zu haben. Der Markt soll es regeln.
Auf einer kleinen Inselgruppe in Honduras war man schon fortgeschritten dabei, in einer »Sonderentwicklungszone« namens »Prospera« eine solche Privatstadt zu entwickeln; einer der Hauptinvestoren war der US-amerikanische Tech-Milliardär und Paypal-Gründer Peter Thiel, der großen Einfluss auf die Politik der Regierung Trump hat. Doch nach den Wahlen 2021 verlor das Projekt den Rückhalt der honduranischen Regierung. In weiteren Ländern in Afrika, Süd- und Mittelafrika hat das Netzwerk um Thiel ähnliche Orte geschaffen, die derzeit als Experimentierräume dienen.
Die proprietaristische Vision der »Free Cities«, ist ein Albtraum. Die Privatstädte wären eine Plutokratie und ein Rückfall in einen Feudalismus, der seit dem 19. Jahrhundert in Europa eigentlich überwunden schien. Ohne gesellschaftlich kontrollierte Instanz, heute in Form des Rechtsstaats, würde Willkür herrschen. Ein Großteil der Arbeit würde von rechtlosen und abhängigen Tagelöhner*innen geleistet; Bildung, Gesundheit und Infrastruktur würden privatisiert; Naturschutz- und Klimaschutz fänden wohl nicht mehr statt und letztlich käme es zu Kriegen zwischen Privatmilizen, in denen sich die Rechtlosen und Abhängigen verdingen müssten.
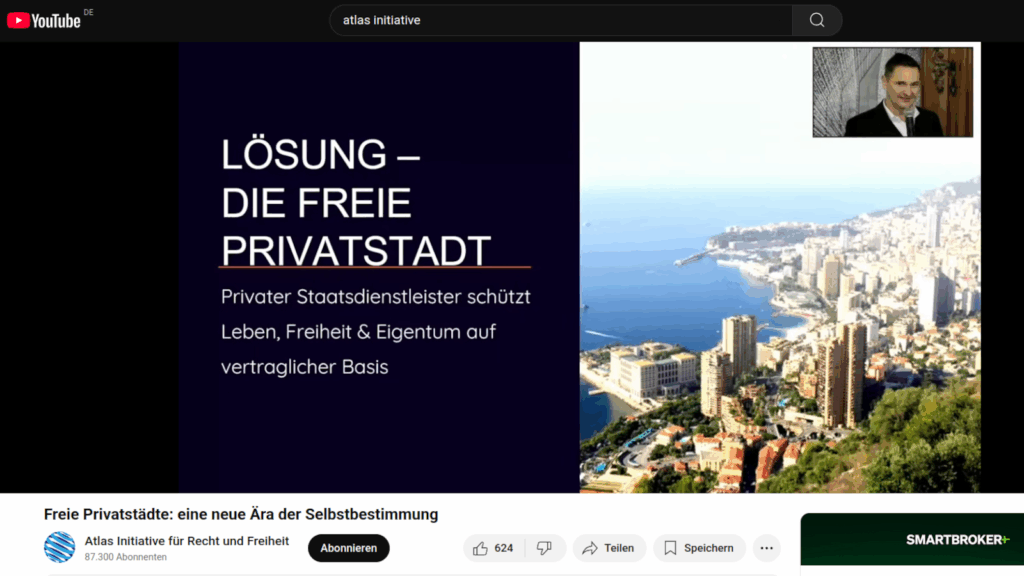
Das europaweit bedeutendste Sprachrohr der Verfechter der »freien Privatstädte« ist die Free Cities Foundation mit Sitz in Liechtenstein. Eine zentrale Person ist deren Foundation Council President, der in Monte Carlo wohnhafte deutsche Staatsbürger Titus Gebel. Förderer ist der bereits genannte Peter Thiel. Gebel und Thiel sind Anti-Demokraten. Von Thiel stammt das Zitat aus dem Jahre 2009: »I no longer believe that freedom and democracy are compatible.« Auch Gebel bringt deutlich zum Ausdruck, dass er Demokratie als Staatsform ablehnt und von Unternehmern beherrschte Privatstädte als Alternative zur demokratischen Gesellschaft sieht.
Wie nah sind sich Proprietarismus und Neofaschismus?
In der Idee der »Free Cities« zeigt sich die geistige Nähe zwischen dem proprietaristischen Milieu und NeofaschistInnen: Gebel sieht in den Privatstädten auch die Lösung der angeblichen Migrationsprobleme des globalen Nordens. Sein Ansatz unterscheidet sich nicht wesentlich vom »Masterplan zur Remigration«, den der österreichische Neonazi Martin Sellner am 25. November 2023 in Potsdam einem ausgewählten Kreis von FunktionsträgerInnen von AfD, WerteUnion und der neofaschistischen Identitären Bewegung vorstellte. Das Treffen sollte intern bleiben, wurde jedoch aufgedeckt und löste eine bundesweite Welle von Protesten aus.
Ein Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion wenig Beachtung fand, ist eben jener der Privatstädte: Auch Sellner schwebt vor, beispielsweise in Nordafrika Land zu erwerben und dort »Musterstädte« zu errichten, in die man massenhaft Migrant*nnen abschieben könnte. Diese Städte sollten von Unternehmern geleitet werden, den dorthin Deportierten käme de facto die Rolle von Arbeitssklaven zu. Tatsächlich hat die AfD schon 2021 versucht, im Bundestag einzubringen, die Bundesregierung solle die Einrichtung privatwirtschaftlich organisierter »Charter Cities« in nordafrikanischen Staaten vorantreiben.
Die Idee der AfD fügt sich in die Abschiebefantasien der NeofaschistInnen ein. Denn Abschiebungen sind mitunter schwer durchzuführen, weil dasjenige Land, in das abgeschoben wird, dabei kooperieren muss – was nicht immer der Fall ist und damit die Forderungen der rechten Parteien unglaubwürdig werden lässt, da die Umsetzung unrealistisch ist. Die britische Regierung hatte 2023 versucht, Ausreisepflichtige ungeachtet ihres Herkunftslands nach Ruanda abzuschieben – ein Deal mit einem autoritären Regime und ein menschenverachtender Plan, der von britischen Gerichten gestoppt wurde.

Die Idee der »Charter Cities« geht noch weiter: Sie sieht die Errichtung neuer Städte vor, in diesem Fall nahe der Mittelmeerküste, die von Privatunternehmen verwaltet werden, die sich verpflichten, die Abgeschobenen aufzunehmen. Dem nationalen Recht des jeweiligen Staates unterlägen diese Städte nicht, die dorthin Abgeschobenen hätten somit keinerlei Arbeitnehmerrechte. Eine Ausreise soll, je nach Konzept, gar nicht oder nur gegen Geldzahlungen möglich sein. Das Ergebnis wären letztlich Freiluftgefängnisse, in denen illegalisierte Migrant*innen für die Profite von Privatunternehmen schuften müssten.
Eine der OrganisatorInnen des Potsdam-Treffens war die Berliner Unternehmerin Silke Schröder, die in der AfD-Zeitung Deutschland-Kurier publiziert. In einem Propagandavideo der proprietaristischen Atlas-Initiative polemisiert sie gegen eine angeblich »ungebremste Migration von illegalen Einwanderern nach Europa«, die »wirtschaftlich wenig beitragend« seien. Auch andere Personen aus dem proprietaristischen Spektrum nahmen am Potsdam-Treffen teil, so Ulrich Vosgerau, Mitglied der Friedrich A. von Hayek-GesellschaftDie Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft ist eine der einflussreichsten proprietaristischen Organisationen im deutschsprachigen Raum. Einer kompromisslosen, marktradikalen Ideologie folgend bietet sie eine Plattform für die Leugnung der Fakten des Klimawandels und für damit zusammenhängende Verschwörungserzählungen. Die Hayek-Gesellschaft hat ihren Sitz in Freiburg und ihre Geschäftsstelle in Berlin. Bis in die 2010er Jahre stand sie der FDP nahe. Um die Frage… Weiterlesen und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.
Die rechten Privatstädte sind auch in Deutschland keine Hirngespinste einer fernen Zukunft. Seit 2023 unternimmt eine Bürgergenossenschaft Mittelsachsen den Vorstoß, einen derartigen Ort in Döbeln (Mittelsachsen) zu errichten. An dem Projekt beteiligt ist der Dresdener Steuerberater Matthias Gertz. Er ist »Botschafter« der Free Cities Foundation und nahm an mindestens einer Veranstaltung der neonazistischen Freien Sachsen teil, die er besucht haben will, weil die Freien Sachsen »Themen wie wirtschaftliche Freiheit und Selbstbestimmung verfolgten«. Der Norddeutsche Rundfunk zitiert aus einem Protokoll der Bürgergenossenschaft Mittelsachsen, in der eine »Kooperation mit den Freien Sachsen« aufgeführt ist. Zu den Geldgebern des Projektes zählt die Atlas-Initiative mit Sitz in Frankfurt (siehe Artikelserie Teil 4).
Richtungsweisend für die extreme Rechte?
Heute scheinen Nationalismus und Proprietarismus um die Rolle als Leitideologie der extremen Rechten im Rahmen einer neuen faschistischen Formierung zu konkurrieren. Das zeigt sich auch in der AfD, wo man sich in Sachen Wirtschaftspolitik nicht einig ist. Noch in ihren Anfangsjahren war die Partei durchweg von proprietaristischen Ideen geprägt. Doch im Laufe der Jahre gewann in ihr der völkische Nationalismus zunehmend an Bedeutung, den vor allem der Kreis um Björn Höcke vertritt. Ein Ideengeber hierfür ist das neofaschistische Spektrum um das ehemalige Institut für Staatspolitik, dem auch Sellner zugehört. Dort redet man gern vom »solidarischen Patriotismus«, eine kaum versteckte Chiffre für »nationalen Sozialismus«. Man befürwortet ein staatliches Sozialsystem, das jedoch ausschließlich Deutschen (nach völkischen Kriterien) zugute kommen solle. Dem gegenüber wirken in der AfD ebenso sozialstaatsfeindliche proprietaristische Kräfte. Die treten zwar nicht allzu offen nach außen auf, haben jedoch deutlichen Einfluss auf das Parteiprogramm. Welche Position sich letztlich durchsetzen wird, ist derzeit offen.

Das Verhältnis der proprietaristischen Szene zu Trump ist nach den bisherigen Monaten der Trump-Administration gespalten: Einige sehen in ihm weiterhin einen Heilsbringer, der den Bürokratie- und Staatsabbau in atemberaubendem Tempo vorantreibt. Andere sind ungehalten darüber, dass die erhoffte »Disruption« (gemeint ist damit eine radikale antidemokratische Revolution) ausbleibe. Wieder andere warnen inzwischen gar vor ihm; seine aggressive Zollpolitik und sein nationaler Protektionismus wirken auf Fans des freien Marktes zunehmend abschreckend. Sein früherer Einflüsterer Musk stänkert inzwischen von der Seitenlinie gegen den US-Präsidenten. Die ultrarechten Milliardäre wie Peter Thiel halten dagegen bislang zu ihm.
Ungebrochen ist dagegen der begeisterte Blick der Proprietarist*innen auf Javier Milei in Argentinien, der sich selbst als »libertär« bezeichnet und ankündigte, die »Kettensäge« an den Sozialstaat anlegen zu wollen. Sein Sozialkahlschlag führt in Argentinien zu einer massenhaften Verarmung in der Bevölkerung.
Für Deutschland ist nichts Positives zu erwarten: Friedrich Merz vertritt auf ganzer Linie die Politik des neoliberalen Kapitalismus. Bis zum Jahr 2020 war er Aufsichtsratsvorsitzender des deutschen Ablegers des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock und gab den Posten nur auf, um seine politischen Ambitionen voranzutreiben. Mit ihm als Bundeskanzler wird sich der politische Spielraum des Proprietarismus erweitern.
In der antifaschistischen Zivilgesellschaft wird die Bedrohung durch die proprietaristische Rechte bislang nur wenig diskutiert. Doch ist es dringend notwendig, den Blick zu weiten und diese als die Gefahr zu erkennen, die sie tatsächlich darstellt.
Weitere Teile der Artikelserie:
Die Erben Hayeks. Die Hayek-Gesellschaft und der Hayek-Club Frankfurt (2/5)
Wie tief das proprietaristische Milieu in Wirtschaftsverbänden und in der Frankfurter Stadtgesellschaft verankert ist, macht der Blick in den Hayek-Club Frankfurt deutlich. Der steht politisch der FDP nahe und grenzt sich von der AfD ab. Doch führt er einen rechten Kulturkampf gegen Sozialstaat, Nachhaltigkeitspolitik, Linke und »Wokeness«. LESEN
Jung. Liberal. Egoistisch. Proprietaristischer Nachwuchs an den Universitäten (3/5)
An den Universitäten formieren sich proprietaristische Gruppen wie die Students for Liberty und Liberty Rising. Sie führen gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit im Programm und senden die Botschaft des »Weiter so!«. So präsentieren sie sich als Gegenpol zu emanzipatorischen Bewegungen, die für Klimaschutz, Ökologie und Diversität eintreten. LESEN
Gegen die „New World OrderDie »Neue Weltordnung« / »New World Order« (kurz NWO) ist ein übergeordneter Verschwörungsmythos. Sie bildet das »Dach« vieler einzelner Erzählungen, die in der rechten Verschwörungsszene kursieren. Demnach strebe eine »globalistische Elite« eine totalitäre Weltregierung an. Ihr Ziel sei die Abschaffung jeglicher Freiheitsrechte sowie die Steuerung der Gedanken, um die Menschen einer umfassenden Kontrolle zu unterwerfen. Zu ihrer Durchsetzung würden die… Weiterlesen“. Die rechte Verschwörungsszene im Sog des Proprietarismus (4/5)
ProprietaristischesRechter Libertarismus und Proprietarismus bezeichnet ein Spektrum und ein Ideologiegebäude, das antiegalitär und in vielerlei Hinsicht antidemokratisch ist. Es ist in der rechten Verschwörungsszene weit verbreitet. Proprietarismus meint die Fixierung auf Eigentumsrechte und die Ablehnung aller staatlichen Eingriffe in diese. Die dort vertretene »freiheitliche« Idee ist rein egoistisch. Sie basiert auf Marktradikalismus und darauf, dass sich Besitzende und Reiche sozialen… Weiterlesen Denken hat großen Einfluss in der rechten Verschwörungsszene. Auch viele ReichsbürgerInnen sowie UnternehmerInnen im Esoterik-Business vertreten eine strikte marktradikale Ideologie. Sie wollen sich von Staat und Gesellschaft loslösen und suchen nur den eigenen wirtschaftlichen Vorteil. Ihre Netzwerke reichen bis in die »gehobene Gesellschaft«. LESEN
Geschäfte mit Angst und Gold (5/5) – in Arbeit
Prophezeiungen des baldigen Systemzusammenbruchs und des wirtschaftlichen Niedergangs sind das Geschäft proprietaristischer Crash-Propheten. Sie verbinden diese Szenarien mit Anlagetipps in Edelmetalle und Kryptowährungen. Die Atlas-Initiative mit Sitz in Frankfurt ist ein Lautsprecher dessen. Sie will den Umsturz und schmiedet Bündnisse mit extremen Rechten.
